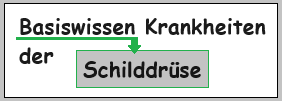Wichtige Nährstoffe bei Erkrankungen der Schilddrüse
– Nachfolgend lesen Sie einen bezahlten Blogbeitrag (Gastartikel) –
Der nachfolgende Text wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Katharina Heinz. Homepage: www.ReineProdukte.de
Erkrankungen der Schilddrüse kommen in Europa zwar häufig vor, ließen sich in vielen Fällen aber leicht vermeiden. Die Schilddrüse ist auf eine ausreichende und regelmäßige Versorgung mit den richtigen Nährstoffen angewiesen, um normal zu funktionieren. Insbesondere die Spurenelemente (Link geprüft am 15.09.23) Selen, Jod, Zink und Eisen nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Eine Mangelversorgung kann bestehende Erkrankungen der Schilddrüse verschlimmern und deren Entstehen sogar verursachen. Continue reading „Wichtige Nährstoffe bei Erkrankungen der Schilddrüse“